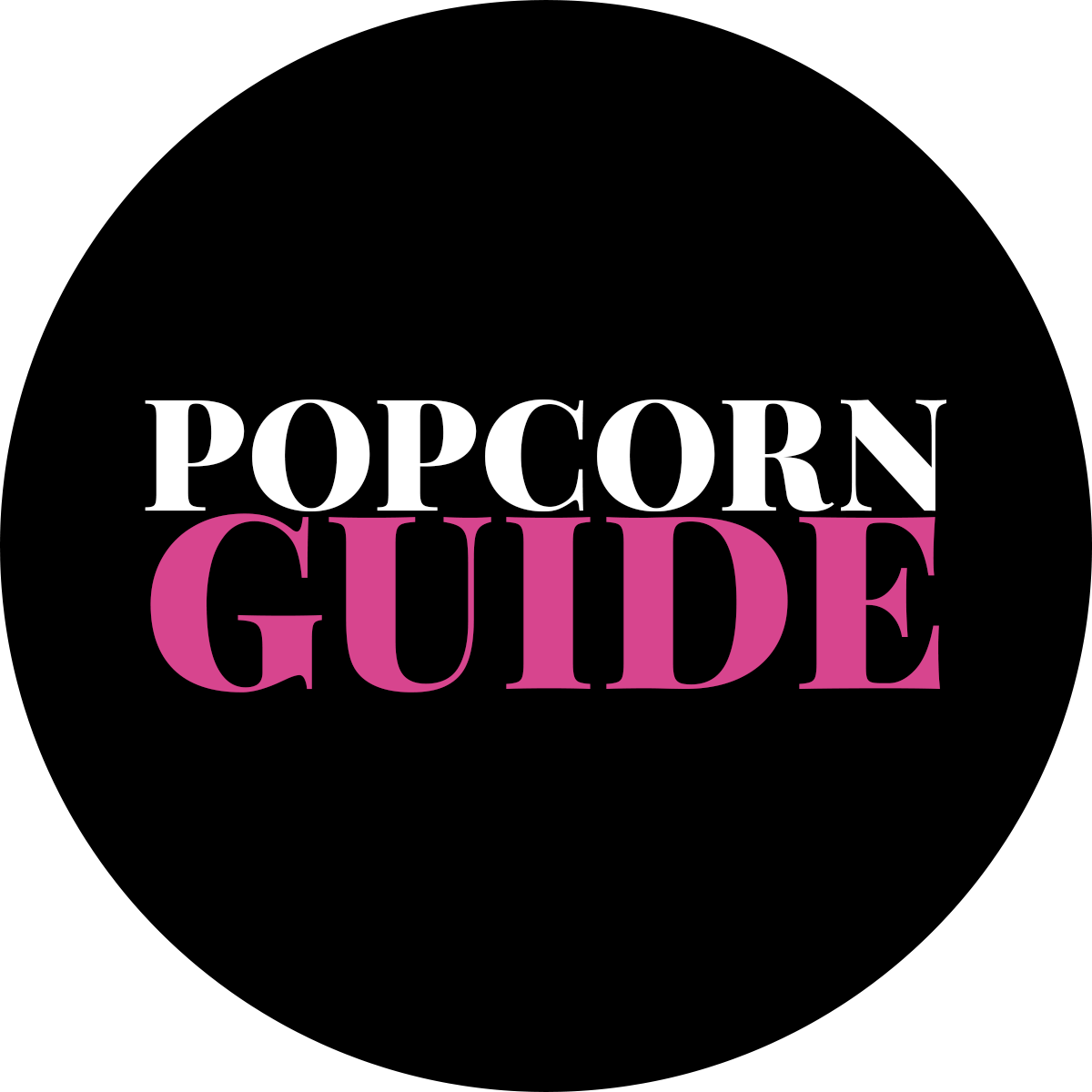One Battle After Another
© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.
„One Battle After Another“: Paul Thomas Anderson inszeniert einen Pop-Revoluzzer – und bleibt seltsam unentschlossen
Bildgewaltiges Kino zwischen Geniestreich und Gefühlslücke: Warum One Battle After Another beeindruckt, aber nicht ganz erfüllt.
Was passiert, wenn einer der stilprägendsten Regisseure Hollywoods einen Revolutionsfilm dreht? Paul Thomas Anderson liefert mit One Battle After Another eine aufwändige, fast dreistündige Kinoerfahrung, die vieles richtig macht – und doch nicht ganz den Nerv trifft, den sie zu treffen versucht. Zwischen berauschender Ästhetik, starkem Schauspiel und politischer Ambition steckt ein Film, der große Versprechen gibt, aber nicht alle einlöst.
PTA liefert erneut formvollendetes Kino
Allein auf der visuellen Ebene ist One Battle After Another eine Wucht: Gedreht in edlem Vistavision, mit langen, gleitenden Kameraeinstellungen, Close-ups voller Ausdruck und dieser typischen Paul-Thomas-Anderson-Ruhe, die aus Alltagsszenen Kinomomente macht. Die Kamera erzählt, bevor Worte gesprochen werden. Und über allem liegt Jonny Greenwoods großartiger Score, der die Geschichte nie übertönt, sondern einbettet – mal melancholisch, mal treibend, mal hypnotisch.
PTA lässt seine Darsteller:innen glänzen: Leonardo DiCaprio spielt Bob – einen bekifften, verwahrlosten Vater mit Revoluzzer-Gen – zwischen Lebowski und Guevara, zwischen tragikomischer Figur und widerwilligem Helden. Chase Infinity beeindruckt mit Wucht, Benicio del Toro bringt als abgeklärter Mentor Tiefe ins Spiel, und Sean Penn liefert als faschistoider Colonel Lockjaw eine detailverliebte, aber überzeichnete Performance ab. Der Film gibt seinen Figuren Raum – und macht aus Gesichtern Landschaften.
© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.
Zwischen politischem Anspruch und Pop-Märchen
Und doch bleibt ein schales Gefühl zurück. Denn One Battle After Another wirkt in seinem politischen Anspruch überraschend oberflächlich. Die faschistische Bewegung, angelehnt an realweltliche MAGA-Rhetorik, wird karikaturenhaft gezeichnet. Die Rechten sind gefährlich, ja – aber vor allem lächerlich. Das Lachen über sie mag erleichternd sein, doch es nimmt ihnen die Bedrohlichkeit. Es fehlt die Wut, das Unbehagen, das Nachhallen.
Auch die idealistische French-75-Bewegung wird vielversprechend eingeführt – nur um bald wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Statt kollektiver Auflehnung steht wieder die individuelle Heldenreise im Vordergrund. DiCaprios Bob rückt ins Zentrum, die Revolte in den Hintergrund. Was bleibt, ist weniger Widerstandserzählung, mehr Pop-Revoluzzer-Saga mit ironischer Brechung.
Der Vergleich mit Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood drängt sich auf: Auch dort wird mit realer Gewalt gespielt, aber durch Ästhetik und Perspektivwechsel gezähmt. Auch Anderson setzt auf dieses Prinzip: Er verlagert Gewalt an den Rand des Bildes, zeigt Lager, Leid, Zerstörung – aber aus sicherer Distanz. Der Schrecken bleibt Teil der Kulisse, nicht des Erlebnisses. Das wirkt elegant – aber auch wie ein Rückzieher.
Ein Antagonist ohne Angst?
Besonders deutlich wird das beim Bösewicht: Sean Penns Lockjaw ist eine Machtdemonstration in Schauspielkunst – jede Bewegung sitzt, jede Geste ist kalkuliert. Und doch bleibt er als Figur seltsam harmlos. Als Zuschauer spürt man seine Rolle, erkennt seine Position – aber man fürchtet ihn nicht. In vielen Kritiken wird der Vergleich mit Hans Landa (Christoph Waltz in Inglourious Basterds) bemüht. Aber Landa war eiskalt und kalkuliert – Lockjaw wirkt wie eine Karikatur mit Uniform.
Andersons Film will den Schrecken nicht ins Zentrum rücken – sondern den Widerstand. Nur verliert er dabei manchmal das Gewicht, das echter Widerstand braucht.
© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.
Das große Finale: Kino, das unter die Haut geht
Und dann kommt sie doch, die Gänsehaut. Das Finale. Eine Verfolgungsjagd in der Wüste, die filmisch ihresgleichen sucht. Keine hektischen Schnitte, keine CGI-Explosionen – stattdessen: Staub, Windschutzscheiben, Hügel, Weite. Die Kamera bleibt ruhig, das Tempo hoch. „One battle after another“ – visuell übersetzt in eine endlose Abfolge von Anstiegen, Gefahren, Entscheidungen.
Inmitten dieser Szene: Willa, Bobs Tochter. Sie trifft die klügste Entscheidung des Films. Sie stoppt. Sie steigt aus. Sie entzieht sich dem Tempo, verlässt das Spielfeld – und zwingt ihren Verfolger durch diesen passiven Akt in die Niederlage. Es ist kein Kampf mit Waffen, sondern mit Verstand. Kein Gegenschlag, sondern ein Rückzug mit Wirkung. In diesem Moment steckt alles, was der Film sagen will. Und endlich tut er es laut.
Fazit: Stark, stilvoll – und doch nicht mutig genug
One Battle After Another ist ein grandios inszenierter Film mit herausragenden Bildern, viel Herzblut und starken Darstellungen. Paul Thomas Anderson zeigt einmal mehr, wie sehr er das filmische Handwerk beherrscht – von Kamera bis Casting, von Sound bis Schnitt. Und trotzdem bleibt die Frage: Warum nicht mehr? Warum nicht mutiger, radikaler, eindringlicher?
Vielleicht, weil der Film lieber ästhetisiert als anklagt. Vielleicht, weil PTA lieber beobachtet als konfrontiert. Vielleicht, weil seine Form von Kritik leise sein will – statt laut.
Und vielleicht ist das auch okay so.
Denn am Ende zeigt dieser Film, dass Revolution nicht nur in Sprengsätzen steckt. Manchmal reicht es, das Tempo zu stoppen.
© 2025 Warner Bros. Entertainment Inc.